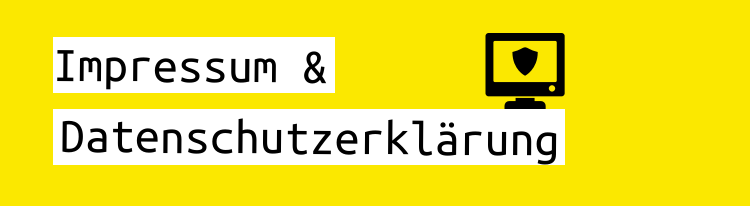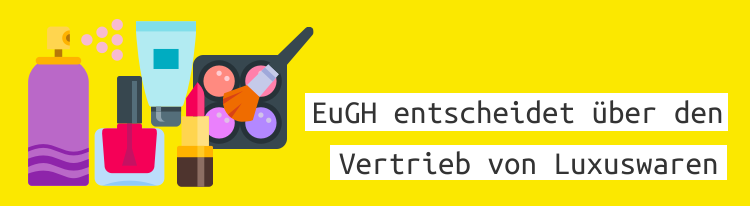Digital Commerce Blog
In diesem Blog finden Sie die neuesten Informationen über den digitalen Handel - einschließlich des Verkaufs von Waren und Dienstleistungen über E-Commerce-Kanäle, mobile Netzwerke und Informationen über notwendige und geeignete IT-Infrastrukturen. Weiter lesen
Beiträge über:
Recht
Neues Jahr – neue Rechtslage für Online-Händler ab 2019
Auf der sicheren Seite: Impressum und Datenschutzerklärung
Datensicherheit im digitalen Handel: EU-US Privacy Shield hält stand
Geoblocking-Ende: Das Wichtigste für Online-Händler zum EU-Kompromiss
EuGH ermöglicht Einschränkung des Online-Vertriebs von Luxusartikeln über Amazon und Ebay
Pflicht vor Kür: Das neue Verpackungsgesetz für Online-Händler
Thema grenzüberschreitender Datentransfer: Was ist was im internationalen Datenschutz?
Neues Gesetz: Bei fehlender Datenschutzerklärung droht die Abmahnung
Mehrwertsteuer im Online-Shop: Abmahnung wegen unzureichender Angaben?
Wir schreiben über aktuelle Software-Updates von Shopware 6, Shopify, BigCommerce und weitere E-Commerce-Plattformen. Außerdem stellen wir neue Produkte und Plugins für Ihren Online-Shop vor. Erfahren Sie, wie Sie mithilfe von Zusatzsoftware Zeit im Online-Marketing sparen und sich neue Möglichkeiten der digitalen Ansprache Ihrer Kund:innen erschließen.
Aber nicht nur E-Commerce-Software ist ein Thema. Kein Online-Shop kommt ohne Marketing aus. So finden Sie bei uns Blog-Beiträge zu Suchmaschinen-Marketing, E-Mail-Marketing, Social Media und Content Marketing. Wir geben Tipps und zeigen am Beispiel, wie Sie über Instagram, Facebook, Twitter, Pinterest und andere Plattformen Ihre Zielgruppe erreichen. Content ist immer ein Thema und so fragen sich viele Online-Händler und -Händlerinnen, ob ein Corporate Blog, ein Online-Magazin oder eine Optimierung der Kategorie-Texte eher von Google gewürdigt wird und potenziellen Kund:innen hilft, den Online-Shop einfacher zu finden. Gerne zeigen wir Ihnen am Beispiel, wie Sie SEO-Texte schreiben und SEO-Maßnahmen umsetzen, die nicht nur Ihre Sichtbarkeit bei Google verbessern, sondern das Usererlebnis Ihres Shops optimieren und in erster Linie dafür sorgen, dass sich Ihre Kunden und Kundinnen gut aufgehoben fühlen.
Wir helfen Ihrem Unternehmen mit Informationen zu den ersten Schritten im E-Commerce und bewahren Sie vor häufigen Fehlern beim Start Ihres eigenen Online-Shops. Wir schreiben über Events und E-Commerce-Trends, stellen unsere größten Erfolgsprojekte als gutes Beispiel für gelungene Shops vor und teilen mit Ihnen unser Know-how zum Thema E-Commerce sowie nützliche Tipps rund um den Handel im Internet. Egal, ob für Ihren Start in den Online-Handel, die Erweiterung auf Multi-Channel-Commerce oder die Entwicklung ausgefeilter Strategien für den B2B-E-Commerce: Wir freuen uns über jeden Tipp, den wir Ihnen geben können, um Ihren Online-Shop erfolgreicher zu machen und unterstützen Sie gerne beim Meistern Ihrer individuellen E-Commerce-Herausforderungen.